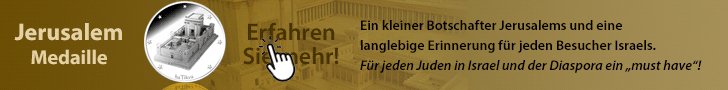
Am 8. November des Jahres 1937 wurde eine der größten und folgenreichsten Wanderausstellungen der deutschen Geschichte eröffnet. Auf über 3.500 Quadratmetern wurde „der ewige Jude“ dem Volk präsentiert.
Das Publikum kam aus allen Teilen des Reiches in Bussen herbei und auf die erste Schau in München mit über 400.000 Besuchern folgten Stationen in allen großen Städten, im seit März 1938 nationalsozialistischen Wien ebenso wie in der Reichshauptstadt Berlin.
Höhepunkt der Ausstellung war ein „Weiheraum“, in dem am Ende des Rundgangs die „Erlösung“ des „Deutschen Wesens“ durch die Rassegesetze von Nürnberg gefeiert wurde. Das Plakat der Ausstellung, überall im Reich zu sehen, wurde zur Ikone des Antisemitismus. Der „ewige Jude“ ist ein Bettler mit verschlagenem Ausdruck, der in seiner zum Betrachter ausgestreckten Hand vier Münzen hält. Hinter seinem Rücken hat er schon halb Europa unter den Arm geklemmt, genauer, die Sowjetunion. Nun will er den Rest. Seine Augenlider sind zugeschlagen, devot und hinterhältig wie die ganze kriecherisch gekrümmte Gestalt, die gleichwohl eine Peitsche in der Hand hält, bereit, den Ahnungslosen zu schinden, der auf sie hereinfällt. Der Bettler, der heimlichen Reichtum besitzt, der scheinbar Schwache, der über geheime Macht verfügt, der Blinde, der sein Wissen verbirgt, der Undurchsichtige, der seine Absichten nicht preisgibt.

Installation der Ausstellung: Die als Skelette dargestellten Juden halten Gold, Peitschen, Hammer und Sichel in ihren Händen. Foto RolfvonAmeln
Das traditionelle Bild des ewigen Juden, der in den Augen der Christenheit zur Strafe für seine Sünden auf immerwährende, rastlose Wanderschaft geschickt wurde, vereinigt in dieser nationalsozialistischen Ikone zugleich die Sinnbilder kapitalistischer und kommunistischer Macht. Die Karikatur eines Feindbildes, in der nun alles zusammenfließt, was gehasst werden soll. Das Plakat vertraute noch ganz auf die populären, emotionalisierenden und häufig pornografischen Bildwelten eines „Radauantisemitismus“, wie sie die Nazizeitung „Der Stürmer“ – von den nationalsozialistischen Eliten Eliten als nützlicher Krawallmacher belächelt – verbreitete. Die Ausstellung hingegen setzte auf das, was Adolf Hitler schon im Jahre 1920 einen „Antisemitismus der Vernunft“ genannt hatte. Uralte Fantasien von Weltverschwörung und gheimer Macht sollten im Gestus einer unbestechlichen „Sachlichkeit“ in scheinbar moderne Wissenschaft verwandelt werden.
Mit den vorgeblich objektiven Mitteln der Fotografie sollte die deutsche „Volksgemeinschaft“ zusammengeschweißt werden, sich in der Abscheu von dem Bild des schlechthin „Anderen“ – „des Juden“ – mit dem eigenen, deutschen Wesen identifizieren. In zwanzig Sälen wurden in verschiedenen Ausstellungsabteilungen der „Einfluss der Juden in allen Gesellschaftsbereichen“ und die „moralische Verkommenheit der Juden“ als „Tatsachen“ präsentiert, zu deren Untermauerung ein ganzes Arsenal von Exponaten aufgeboten wurde, die allesamt nur das „bewiesen“, was man in ihnen sehen wollte: physiognomische Modelle und Karten, Statistiken und Zeitungsausschnitte aus der Weltpresse – und eben: unzählige Fotos. „Juden selbst über Juden reden zu lassen“, so hieß es, sei das Prinzip dieser Schau. Wie das ging, wird noch zu zeigen sein. Was die Ausstellungsmacher unter „Sachlichkeit“ verstanden, schrieb der „Völkische Beobachter“ am 16. Januar 1938: „Symbol des Unheils: Stürzende Wände. Neue Wege in der Ausstellungsarchitektur. Eine politische Schau, die den Besucher aufrütteln und ihm Erkenntnisse einbrennen will, muß Dissonanzen enthalten, mit grellen Klängen muß sie die erschlaffende Aufmerksamkeit immer wieder anstacheln und in einem ständigen Crescendo den Betrachter durch die Räume führen.“
Immer wieder ist von Emotionalisierung die Rede, die den Besucher zur gewünschten Wirkung führen soll. Und die Ausstellungsarchitektur gemahnt an sakrale Räume. „Den ersten Saal, in dem den Besuchern die rassischen Merkmale der Juden vor Augen geführt werden, gestaltete diese Arbeitsgemeinschaftt junger Werbefachleute, Architekten, Maler und Gebrauchsgraphiker kreisrund. Damit wurde die Raumwirkung eines Pantheons der unbestechlichen wissenschaftlichen Sachlichkeit und Klarheit erreicht. Der anschließende lange Gang, der die Dokumente der jüdischen Entwicklungsgeschichte bis ins 19. Jahrhundert enthält, hätte einen Ausstellungsarchitekten der alten Schule zu einer dekorativen Aneinanderreihung verleitet. Hier kam man auf die verblüffende Idee, eine wellenförmig geschwungene Wand als Bildträger vor die massige Mauer zu setzen, eine Wand also, deren Kurven den Zuschauer fast suggestiv in die Tiefe des Raumes hineinlocken. Der Alp, der sich beim Durchschreiten dieses Infernos auf die Brust legt, wird noch beklemmender in den folgenden Räumen, deren Wände mit grinsenden Judenfratzen auf einen zustürzen.“
„Judenfratzen“ zu zeigen, das war seit dem Mittelalter eine europäische Obsession, hervorgerufen durch das nie geklärte Verhältnis des Christentums zu seinen eigenen jüdischen Wurzeln, ein Verhältnis, das zweideutig bleiben musste, denn weder war es möglich, diese Wurzeln abzuschlagen, noch den Anspruch aufzugeben, sie überwunden zu haben. So bedrohten nicht die Juden, sondern das eigene Verhältnis zum Judentum die Identität. Eine Gefahr, die unsichtbar bleiben musste, weil sie in einem selber lag – und die Fantasien weckte über jüdische Heimlichtuerei und Verschwörung. Nur so war das Unbehagen nach außen zu wenden. Mit dem Eintritt der Juden in die moderne Gesellschaft blieb nicht einmal die äußere Erkennbarkeit übrig, und so ging der Hass auf das Jüdische in eine neue Form über den antisemistischen Anspruch, das „Jüdische“ hinter allen Masken quasi wissenschaftlich aufzuspüren; – eben als „Rasse.“
Doch wie nur konnte der „Jude ohne Maske“ einem Massenpublikum „sachlich“ präsentiert werden? Wie konnte der Hass auf das Jüdische, das man nicht los wurde, das an einem „klebte“, weil es an der wiege der europäischen Kultur stand, nicht im Schmuddelstil der Karikaturen des „Stürmers“, sondern gleichsam „emotionslos“ verbreitet werden? Das „Pantheon“ der wissenschaftlichen Objektivität antisemitisch inszenierter Fratzen blieb am Ende seltsam blass gegenüber einem anderen Medium, das in der Rezeption der Ausstellung besondere Wirkung entfaltete und aus der Sicht von heute die Erbärmlichkeit des ganzen Unternehmens auf einen Nenner brachte: Die Ausstellung wurde von einem Filmstreifen begleitet, der im Stundentakt dem Besucher vorgeführt wurde.
Und als gälte es das Realitätsprinzip vollends auf den Kopf zu stellen, sollte das wahre jüdische Wesen hier auf jenen fiktionalen Filmrollen destilliert werden, die Juden im Kino spielten, „Juden ohne Maske“ lautete der Titel dieser Zusammenstellung komplizierter Szenen aus bekannten deutschen Spielfilmen, in denen Juden als Mörder zu sehen waren, oder in denen sie „deutsches Kulturgut“ wie den „Alpinismus“ verächtlich machten. Das Geständnis des von Peter Lorre gspielten Kindsmörders in „M. Eine Stadt sucht einen Mörder“ wurde als Bekenntnis „des Juden“ zu seiner mörderischen Natur „entlarvt“. Und der begleitende Kommissar verwandelte die Aneinanderreihung der allzu bekannten Filmszenen in die Aufdeckung eines jüdischen Komplotts: „Jüdische Spekulation zerstört deutsche Wesensart“, „mit dem Gift des Verbrechens führte der Jude seinen Vernichtungskampf“, „wer mit dem Juden kämpft, kämpft gegen den Teufel.“
Der Komplikationsfilm schlug eine Brücke zu dem späteren Nazi-Filmprojekt „Der ewige Jude“, der sich der gleichen Technik und Szenen bediente, und stieß in den Medien wie beim Publikum auf besonderes Interesse. Die „Münchener Zeitung“ bestätigte am 29. Dezember des Jahres 1937 treu und brav: „Im Film ließ der Jude seine Maske fallen, und dieser Film im Besonderen zeigt uns, daß gewisse Rollen eben nur von jüdischen Darstellern in ihrer zersetzenden Art gespielt werden können.“ Der „Westdeutsche Beobachter“ wurde noch deutlicher. Der Ausruf des Kindsmörders im Spielfilm, nichts gegen das Böse zu vermögen, das er in sich zu tragen verflucht sei, wird in der Regionalzeitung der NSDAP zum Programm: „Dieser Schrei ist zugleich ein jüdisches Schuldbekenntnis, eine Selbstenthüllung, die geradezu zur Ausrottung bettelt. Diese jüdische Bettelei muß erfüllt werden..!“ – „Der ewige Jude“ war ein groß angelegter und letztlich erfolgreicher Beitrag dazu, eine Haltung einzuüben, die im Mord eine Erlösung sah und ihn deswegen auch im großen Stil durchführen konnte: eine Erlösung der Deutschen von dem Fremden in sich selbst, das sie nicht loswerden konnten – und natürlich bis heute nicht loswerden können – und die „Erlösung der Juden von ihrer Existenz.“
Von Rolf von Ameln
Redaktion Israel-Nachrichten.org
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende, oder werden Sie Mitglied der Israel-Nachrichten.
Durch einen technischen Fehler, ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet!
Leserkommentare geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Wie in einer Demokratie ueblich achten wir die Freiheit der Rede behalten uns aber vor, Kommentare nicht, gekuerzt oder in Auszuegen zu veroeffentlichen. Anonyme Zuschriften werden nicht beruecksichtigt.