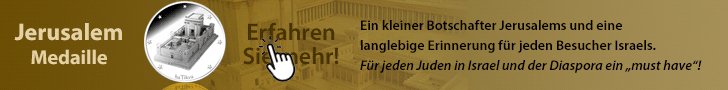
Mitten in Czernowitz war ich gestern Nachmittag im Kammermusiksaal der Philharmonie in Berlin. Sie, Götz Teutsch, haben diese großartige Veranstaltung gestaltet. Wie Sie zu Beginn sagten, holten sie sich Edi Weissmann, der noch in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Czernowitz in eine vielgelittene jüdische Familie geboren wurde, um mit ihm über die jüdische Literatur von damals in seiner Stadt zu sprechen. Czernowitz war vor dem 2. Weltkrieg Zentrum der deutschsprachigen jüdischen Literatur bis die Stadt 1945 sowjetisch wurde und die deutsche Sprache, die Sprache des Feindes wurde. Wie kommen Sie als Siebenbürger Sachse, als Nachfahre von zwei Evangelischen Bischöfen in Siebenbürgen, in Rumänien, zu diesem Thema?

Götz Teutsch und Edi Weissmann in der Philharmonie. Foto: Wollmann-Fiedler
Aus reiner Neugierde. Ich lese ja Paul Celan oder Rose Ausländer seit Jahren. Er ist einer der größten Lyriker des 20. Jahrhunderts. Ich war immer neugierig und fragte mich, woher kommt dieser Mann, von wo ist er und wie entsteht so ein Dichtergenie? Es muss ja ein Umfeld haben, so etwas entsteht ja nicht in der Pampa ohne Hintergrund. So bin ich dann langsam nach Czernowitz gekommen. Ich sage Ihnen, als ich mich jetzt so vertieft habe in diese Welt, in diese Stadt Czernowitz, hat mich Vieles an Siebenbürgen erinnert. Es ist auch dieses Zusammenleben von verschiedensten Völkern, die eigentlich sich ganz gut verstanden haben bis dann eine politische Richtung kam, die den anderen als Feind gestempelt hat, automatisch eine ganze Volksgruppe und die anderen als ganz große Gewinner. Das war in Siebenbürgen so und auch in Czernowitz. Nur war es in Czernowitz viel grausamer. Die Siebenbürger wurden nach Russland verschleppt, während die Juden zum großen Teil umgebracht wurden.
Aber die Verschleppung der Deutschen aus Siebenbürgen hat ja erst 1945 stattgefunden, die Deportationen nach Transnistrien waren viel früher. Das ist kein guter Vergleich.
Czernowitz wurde nach dem ersten Weltkrieg Rumänisch und die Rumänen waren auch nicht viel besser. Sie habe eisern versucht die deutsche Sprache auszumerzen, haben es aber nicht geschafft. Deutsch war zu sehr verankert in der Bevölkerung. Die Judenfeindlichkeit begann schon viel früher. Das ging ja schon nach dem ersten Weltkrieg los.
Ich fange gleich von vorne an. Sie sind in Hermannstadt/Sibiu in Siebenbürgen, inmitten der Karpaten, im 2. Weltkrieg geboren worden, gingen dort zur Schule, doch mit 16 Jahren, so erfuhr ich gestern, schickten Ihre Eltern Sie auf ein Musikgymnasium nach Bukarest, weil Sie besessen vom Cellospiel und vom Musik machen, waren. Wo haben Sie Cello studiert und wo haben Sie Edi Weissmann kennengelernt?
Geboren bin ich in Hermannstadt, meine Familie, die Familie Teutsch, sind Urhermannstädter. Der Bischof Georg Daniel Teutsch war mein Urgroßvater, der andere Bischof, der Fridrich Teutsch, war mein Großonkel. Als ich ganz, ganz klein war ist mein Vater, noch vor meiner Kindergartenzeit, nach Reps versetzt worden. Das ist ein kleiner Marktflecken zwischen Kronstadt und Schäßburg. Er ist als Arzt dorthin bestellt worden, hingeschickt worden und die ganze Familie ist nachgezogen. Für uns Kinder war das ein Segen, in dem Ort gab es kein Auto, keine asphaltierte Straße, man konnte herrlich spielen und Gärten gab es rundherum. Für uns Kinder war es schön, doch für die Eltern ein Alptraum. Wir hatten Schweine, Hühner und Misthaufen, alles, was den Leuten heute abgeht. Das war wirklich so. Mein Musiklehrer im Gymnasium in Schäßburg meinte: „Hier in dem Gymnasium hast Du nichts verloren, Du bist Cellist von Kopf bis Fuß, Du musst das richtig lernen. Das kannst Du nur in Bukarest oder Klausenburg“. Bukarest war dann doch einen Zacken besser, so bin ich nach Bukarest in die Schule gegangen.
Wo haben Sie dann Cello studiert?
Na, ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Mein Vater war Arzt. Er hatte einen Patienten, der nicht bezahlen konnte. Mein Vater hat immer gesagt, wenn die Patienten gefragt haben, was sie zu zahlen hätten: „ Werd‘ gesund, das ist das Beste! Die Mutter hat dann hintenrum für das Geld gesorgt, soweit es ging. Ein Patient war sehr betrübt, weil er Nichts zahlen konnte und hat meinem Vater ein furchtbares Cello geschenkt. Wirklich, ein handgemachtes Cello, selbst gebaut, aber es war ein Cello. In Reps gab es einen Apotheker, den Mederus. Dieser Apotheker hatte in Wien Pharmazie und Klavier studiert. Im Hinterzimmer der Apotheke stand ein Flügel, und ich war sein Klavierschüler, dann auch sein Celloschüler, weil er der einzige war, der Unterricht geben konnte. Obwohl er nicht Cello spielen konnte, war er einer meiner besten Lehrer. Das Kind, das ich war, vielleicht auch ein wenig begabt, wie alle Kinder recht geschickt. Mederus gab mir das Cello in die Hand und eine „Schulung für Selbstunterricht“ beim ersten Cellounterricht. So bin ich bei ihm in die Lehre gegangen und das war großartig, weil er Klavier gespielt hat und ich mit ihm gemeinsam musiziert habe. So bin ich aufgewachsen mit einer ganz natürlichen Art Cello zu spielen, ohne Zwänge und ohne Regeln, wie ich die Hände zu halten habe, und, und, und…Das wurde dann bei mir immer intensiver, so dass ich das Gymnasium in Schäßburg kaum noch ertragen konnte, außer den Deutschlehrer und den Musiklehrer, die fand ich toll. Dann sagte mir der Musiklehrer eines Tages: „Du hast hier am Gymnasium nichts verloren, Du musst nach Bukarest in die Musikschule gehen“. Dort habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht. In dem Musikgymnasium sind sie fast in Ohnmacht gefallen. Ich musste die Aufnahmeprüfung zweimal spielen, weil sie sämtliche Lehrer der Schule zusammengetrommelt haben, um sich dieses Kind, das aus den tiefsten Karpaten kommt, anzuhören. Man nahm mich auf und in meiner Klasse war der Edi Weissmann. Seine Familie war vor den Sowjets nach dem 2. Weltkrieg nach Bukarest zum Onkel geflohen. Ich konnte nur gebrochen Rumänisch und war selig, dass ich mit jemandem Deutsch sprechen konnte. Der Unterricht war Rumänisch, doch nach einem viertel Jahr konnte ich fließend Rumänisch, das war dann überhaupt kein Problem mehr. Aber mit Edi habe ich immer Deutsch gesprochen, auch mit seiner Mutter. So sind wir uns nahe gekommen. Ich hatte aber von Czernowitz gar keine Ahnung. Dann kam hinzu, dass wir beide, Edi und ich in Berlin gelandet sind.
Waren Sie in Schäßburg oben auf dem Hügel im Berggymnasium?
Natürlich, es war ein deutschsprachiges Gymnasium. In der Schule war ich zwei Jahre, achte und neunte Klasse, dann in der neunten Klasse bin ich nach Bukarest übersiedelt und kam in die 10. Klasse des Musikgymnasiums Nr. 1.
Den deutschen Friedhof hinter der Schule am Hang habe ich auch besucht und war restlos begeistert und fühlte mich Jahrzehnte zurückversetzt als ich die vielen deutschen Namen las.
Ja sicher, das ist einer der schönsten Friedhöfe die es gibt.
Mit Ihren Eltern haben sie Deutsch gesprochen?
Natürlich, selbstverständlich, auch mit den Geschwistern, auch mit den Freunden. Deutsch war die Umgangssprache. Rumänisch hat man auf der Straße gesprochen mit den Kindern und Ungarisch mit den anderen. Wir sind dreisprachig aufgewachsen, doch eigentlich viersprachig, wenn man das Siebenbürger Sächsisch noch hinzunimmt.
Nach dem Studium gingen Sie dann in den Westen, wieso und warum, so einfach war das damals ja nicht?
Nein, einfach war es überhaupt nicht. Ich bin nicht in Rumänien geblieben, weil meine Eltern als Deutsche einen Ausreiseantrag für die gesamte Familie gestellt haben. Ich durfte vorher nicht aus dem Land heraus, ich durfte zu keinem Wettbewerb, ich durfte zu keinem Meisterkurs. Das ist für junge Menschen die Katastrophe auf dieser Erde. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in Rumänien, ich liebe die Rumänen. Viele Züge von ihnen, die ich erlebt habe, finde ich fantastisch. Meine erste Frau war Rumänin, die ist leider gestorben. Sie, die Rumänen, waren nicht der Grund, nur diese furchtbare Diktatur, die dort herrschte, die die jungen Leute eingekerkert hat und man sich nicht nach außen bewegen konnte. Damals kamen die bekanntesten Cellisten aus westlichen Ländern nach Bukarest, und ich spielte ihnen vor und sie sagten, komm‘ doch zu mir, Du bekommst ein Stipendium und mehr. Doch die Regierung hat mich nicht gelassen.
Was man in Siebenbürgen damals hat lernen können, in einer furchtbaren Zeit, in der Zeit des Stalinismus, ich bin Jahrgang 1941. Stalin ist in den 50er Jahren gestorben. Es war der reinste Terror in dem Land, mein Vater hat immer gesagt: „Ich weiß nicht, ob ich morgen früh wieder dort aufwache, wo ich heute Abend eingeschlafen bin. Jeden Moment konnte man einkassiert werden und ins Gefängnis gesteckt werden, ohne Prozess, ohne gar nichts. Wir haben trotzdem gelernt mit diesen verschiedensten Ebenen zurecht zu kommen. Wir hatten in Reps natürlich die Deutschen, wir hatten die Rumänen, wir hatten die Juden, wir hatten die Ungarn und hatten die „Zigeuner“. Wir mussten mit allen irgendwie gut zurecht kommen. Das lernt man halt in dieser multikulturellen Welt.
Die Eltern haben den Ausreiseantrag gestellt und sind mit nach Deutschland gekommen, sind sie auch mit nach Berlin gegangen?
Nein, nein, die sind in München geblieben. Mein Vater hat in München noch eine recht gutgehende Praxis gehabt. Wir sind zwischen 1968 und 69 nach München gekommen mit meiner damaligen Frau. Ich habe dann 1969 hier in Berlin Probe gespielt und 1970 meine Stelle bei den Philharmonikern angetreten. Mir wurde auch immer gesagt, dass ich in München nichts zu suchen hätte, ich müsse nach Berlin, das ist das Beste, was es gibt. Herbert von Karajan und die Philharmoniker haben mich Gott sei Dank genommen, und ich bin hier hängen geblieben.
Sie haben eine Familie gegründet fern der Karpatenwelt
Ich hatte mit meiner ersten Frau zwei Söhne, die sind jetzt um die vierzig. Meine Frau starb hier in Berlin an einer unheilbaren Krankheit, und ich habe dann wieder geheiratet.
Dann haben Sie auch Edi Weissmann aus den Augen verloren?
Lange Zeit wusste ich gar nicht, wo er ist. Dann erfuhr ich, dass er in West Berlin beim Radio Orchester gelandet ist, dem heutigen Deutschen Symphonie-Orchester und ich bin bei den Berliner Philharmonikern angekommen. Immer wieder habe ich ihn im Stimmzimmer der Philharmonie getroffen. Wir haben uns jedes Mal wahnsinnig nett unterhalten, doch mehr war damals nicht. Ich hatte zwei Kinder und eine ständig kranke Frau, er war auch beschäftigt mit seinem Alltag. Das ist nun mal so, man verliert sich aus den Augen. Dann kam das Erlebnis beim Geburtstag meiner Cousine, wo ich das Czernowitzbuch auf dem Tisch liegen sah. Ich hatte schon im Hinterkopf, dass ich etwas über Czernowitz machen möchte. Dieser Paul Celan ist für mich wirklich, einer der ganz Großen. Dann fragte ich meine Cousine, wer sich denn in Berlin in Czernowitz auskennt. Na, dann nannte sie Edi Weissmann. Ich rief ihn an und ging mit meiner Frau zu ihm. Er hat mir einen ganzen Tisch mit Büchern ausgebreitet, die Titel hat meine Frau ganz brav abgeschrieben. Die habe ich dann alle bestellt. Meine Czernowitzbibliothek ist sehr, sehr umfangreich. Dann begann ich mich reinzulesen. Das zweite war, dass ich immer mit Edi Zwiespache gehalten habe. Er hat mir immer noch einen Tipp nach rechts und nach links gegeben. Das habe ich in mich aufgenommen, dann hatte ich das ganz große Glück, dass ich Noah Bendix-Balgley als ersten Konzertmeister bei den Philharmonikern habe, der Jude ist und seit seiner Kindheit Klezmermusik macht, zusammen mit Alan Bern. Noah habe ich von meinem Projekt erzählt, er war sofort Feuer und Flamme und hat mir sein jüdisches Musikrepertoir gegeben. Ich hörte mir alles an und zusammen haben wir die Auswahl getroffen. Es ist ja nicht so, dass alles auf meinem Mist gewachsen ist.
Reisen Sie manchmal nach Siebenbürgen?
Ja sicher, in den letzten zwei Jahren war ich nicht da, weil ich einen ganz schweren Unfall hatte. Ich bin vom Berg gestürzt und habe mir die Wirbelsäule gebrochen, war monatelang im Krankenhaus. Es war sehr hart, und ich musste zwangsweise pausieren. Wenn ich in einem Monat nach Berlin zurückkomme, wird der Dorfschreiber von Katzendorf hier sein. Er wird in Katzendorf ein Festival machen und möchte, dass ich im nächsten Sommer dorthin komme. Ich habe viel gespielt bei der Musica Coronensis in Kronstadt, dann bei der Kronstädter Philharmonie, bei der Hermannstädter Philharmonie, bei der Klausenburger Philharmonie. Da war ich immer als Solist in den letzten Jahren. Mit einem Jahr Pause.
Ich habe in Kronstadt mit dem Organisten und Kantor der Schwarzen Kirche Eckart Schlandt vor Jahren ein Gespräch geführt..
Mit dem Ecki, war ich gemeinsam in der Hochschule in Bukarest, sein Sohn Steffen ist so alt, wie meine Söhne.
Ich las, dass Sie 36 Jahre bei den Berliner Philharmonikern spielten und bereits Jahre vor der Pensionierung erster Cellist wurden
36 Jahre war ich bei den Philharmonikern. Ja, das ist so. Ich kam 1970 als Tuttist, als Tuttispieler, zu den Philharmonikern, nach ungefähr vier Jahren wurde die die Solostelle frei. Ich musste mich erneut bewerben und auch vorspielen, bekam die Stelle und hatte sie über zwanzig Jahre. Immer wieder sagte ich mir, wie kann ich die für mich lebenswichtige Aktivität Lesen, d.h. Bücher mit meiner Musik verbinden. Ich hatte Glück, denn manchmal wurde ich vom Rundfunk gebeten, hin und wieder zu Texten Musik auszusuchen. Dabei merkte ich, dass ich dafür ein ganz gutes Händchen habe. Ich ging zum Intendanten der Philharmoniker und habe ihm diesen Vorschlag unterbreitet, dass ich ein aus ein ganz bestimmtes Ziel ausgerichtetes Programm entwerfe, egal, ob es aus der Musik oder der Literatur kommt und dieses Programm mit Texten und Musik auf dieses eine Thema bezogen, umgarne.
So haben Sie dann den Philharmonischen Salon gegründet
Ja, das erste Programm war gleich ausverkauft, dabei ging es um Fanny Mendelssohn, Dietrich Fischer-Dieskau sollte lesen. Das war vor 17 Jahren, seitdem mache ich das. Zunächst habe ich das dreimal in der Saison gemacht. Doch wurde es mir zu viel, dann habe ich es auf zweimal reduziert, seit 10 Jahren, seitdem ich pensioniert bin, mache ich es wieder dreimal. Drei Programme, jeweils zweimal.
In der Vorschau stand auch, dass ein Musikstück von George Enescu gespielt wir, doch es tauchte im Programm nicht auf
Ach, die Vorschau muss fast ein Jahr vorher fertig sein, doch ich komme erst später dazu, das gesamte Programm auszuarbeiten. Damals dachte ich, dass Enescu auch hereinpassen könnte, obwohl er wirklich nichts mit Czernowitz zu tun hat. In Salzburg werde ich mich jetzt einen Monat lang hinter die Lou Andreas- Salome klemmen, die Texte sind fertig, doch die Musikstücke noch nicht, die muss ich nun heraussuchen. Das ist so ein Schwimmen zwischen den einzelnen Komponisten, das sollte man nicht so ernst nehmen. Was am Anfang steht ist nicht so wichtig, was am Ende steht ist wichtig.
Sie suchen, sie wählen aus, Literatur und Musik. Die Schauspieler und die Musiker suchen Sie auch aus?
Ja, klar, das ist eine Ein-Mann-Show, wenn sie so wollen. Ich bin auch Pultträger, ich mache einfach alles
Die Komponisten, die Sie zum Czernowitz-Thema ausgesucht haben, sind meist sehr alte bis auf Alan Bern. Joseph Achron wurde 1848 in eine jüdische litauische Familie geboren und starb 1943 in Hollywood. Sie hatten die Hebräische Melodie a-Moll op. 33 von 1911, ausgesucht.
Der ist von seiner ganzen Musiksprache mit dem Klezmerstil derart verwandt, auch wenn Achron nicht in Czernowitz auf die Welt gekommen ist. Doch das macht gar nichts. Den Geist dieser Musik schreibt er selber, das ist quasi diese osteuropäische Musik, und ich nehme sie halt mit rein. Es ist keine Literatur- oder musikwissenschaftliche Arbeit. Es ist eine ganz subjektive Sichtweise auf irgendein Thema. Ich sträube mich dagegen. Wenn ich Lust habe etwas mit hereinzunehmen, was nach außen nicht passt, aber mir gefällt‘s, dann nehme ich es mit herein.
Dann hörten wir von Alan Bern, Big Train von 1990. Er ist noch ein jüngerer Komponist und wurde 1955 in den USA geboren und lebt jetzt in Weimar.
Nein, in Berlin. Er veranstaltet das Festival Yiddish Summer in Weimar. Er ist mit dem Geiger, Noah Bendix-Balgley, aufgewachsen. Sie sind Kindheitsfreunde und beide haben bei ähnlichen Lehrern gelernt und beide haben Klezmermuusik seit ihrer Kindheit gemacht. Noah Bendix-Balgley ist erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, oder einer der ersten, es gibt ja drei.
Nun noch Joseph Joachim, das ist ja eine Berliner Geschichte.
Joachim ist ein ungarischer Jude und leitete in Berlin das weltberühmte Joachim-Quartett, hat mit der Musikhochschule in Charlottenburg und auch den Philharmonikern sehr viel zu tun gehabt und hat diese Hebräische Melodien op. 9 geschrieben. Ich suchte eine von deutschen Komponisten komponierte jüdische Musik und da ist mir natürlich Joachim eingefallen. Er wurde 1831 im damaligen ungarischen Kittsee, heute Burgenland in Österreich, in eine jüdische Familie geboren und starb 1907 in Berlin.
Das Musikstück Doina und der Gasn Nign hat mir sehr gefallen, ein bisschen Klezmer, aber ein klassischer Klezmer
Natürlich. Diese Musik war ja fließend, die gehört ja nicht in Schubladen gesteckt. Diese ganzen Improvisationen hängen ja wahnsinnig viel mit dem zusammen, der sie spielt. Es ist auch ganz egal, von wo das kommt. Die beiden, die das gespielt haben, sind in einer Welt aufgewachsen, die wunderbar ist und sie spielen das sagenhaft gut.
Dann kam Karol Mikuli, der 1819 in Czernowitz geboren wurde und 1897 in Lemberg gestorben ist, wunderbar anzuhören waren die Klavierstücke
Der ist in Czernowitz geboren worden und war ein sehr bekannter Komponist und Pianist. Den Pianisten ist er heute noch ein Begriff, weil er die gesamten Chopinwerke mit herausgegeben hat.
Er war Chopinschüler in Paris, las ich
Ja, er war Schüler von Chopin und hat sehr viel von Chopin auch in seinen Kompositionen. Das Reizvolle ist an diesen beiden Stücken für Klavier, 48 Airs nationaux roumains, um 1863, und Nr. 1 b-moll: Doina Lento, das sie ja eigentlich osteuropäische Musik sind, aber mit französischem Einschlag von Chopin. Ich finde sie wunderhübsch die beiden Stücke. Mikuli war ein international anerkannter Komponist
Ach, die Mazurka f-Moll, op. 4, ist wahnsinnig schön, ich bin noch immer begeistert. Als letzter ist noch Joel Engel zu nennen. Er war mir nicht bekannt, auch ein russisch-jüdischer Komponist, der im Russischen Kaiserreich 1868 geboren wurde und 1927 in Palästina starb.
Ja, er starb in Palästina, doch er kommt aus dieser östlich, jüdischen Welt. Noah wollte unbedingt diese Chabad er Melodie op 20, Nr. 1 von 1923, spielen. Das passte auch sehr gut in das Programm.
„Yismechu“ vor der Pause.. . Klezmer, festliche Dorfklänge aus einer Welt, die es nicht mehr gibt. Dann ging es weiter mit Sergej Prokofjews Ouvertüre über jüdische Themen op. 34 von 1919
Dieses Stück ist keine Rarität, man kennt es. Es wird selten so schön gespielt, wie es diese Musiker getan haben.
Ciprian Porumbescu, der Komponist, ist neben George Enescu der bekannteste rumänische Komponist von damals. Ich habe ihn deshalb reingenommen, weil er bei Czernowitz geboren worden ist. 1853 wurde er als Sohn eines Orthodoxen Priesters in der Bukowina geboren, starb 1883 in einem kleinen Ort in der Südbukowina.
Die Ballade e-Moll von 1880 fand ich etwas wehmütig und sehnsüchtig
Ja, sehr stark die tiefe Melancholie. Das Konservatorium in Bukarest, welches ich absolviert habe, hieß damals „Ciprian Porumbescu“. Neben dem Cismigu-Park steht dieses schöne alte Gebäude, daneben ein weniger schönes modernes. Es war damals meine Musikhochschule, wo ich mein Staatsexamen gemacht habe.
Dann spielte wieder Alan Bern sein „Reb Itzik’s Nign“
Die sind ja zauberhaft diese Kompositionen von dem Alan.
Dann wurde Max Bruch gespielt, der 1838 in Köln geboren und 1920 in Berlin beerdigt wurde. Ein richtiger Bruch war das, Trauerstimmung begann und es wurde schwermütig
Ja, ja, tieftraurig. Das Kol Nidrei op. 47 von 1880 ist ein jüdisches Gebet und wird in der Synagoge gebetet.
Nach der „Todesfuge“, 1944/45, von Paul Celan und dem Klaviertrio Nr. 2 e-Moll, op. 67, 1944, von Dmitri Schostakowitsch, begann der Niedergang des jüdischen Lebens, der jüdischen Kultur in Czernowitz, es war richtig zu spüren
Das thematische Material dieses Stückes ist ja rein jüdisch und es ist von einer solchen Intensität und einer Meisterschaft komponiert von Schostakowitsch, das hat Nichts seinesgleichen, man kann es mit Nichts vergleichen!
Ich danke Ihnen ganz sehr, dass Sie mir das alles erzählt haben
Christel Wollmann-Fiedler
Berlin im November 2017
Götz Teutsch
goetz.teutsch@t-online.de

Philharmonie in Berlin. Foto: Wollmann-Fiedler
In die Bukowina nach Czernowitz entführte Udo Samel, der sehr bekannte Schauspieler der einst berühmten und legendären Schaubühne in Berlin die Gäste des Philharmonischen Salons. Im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie begann er seine Lesung „Czernowitz is gewen an alte, jidische Schtot…“, doch glauben Sie das nicht meine Damen und Herren: Czernowitz ist eine Welt!
Nach kurzer Zeit durchstreife ich gedanklich die Stadt am Pruth, gehe durch die Gassen der Vielvölkerstadt, in der Deutsch gesprochen wurde, wo Deutsche, Polen, Juden, Ukrainer, Türken, Griechen, Ruthenen und andere halbwegs friedlich miteinander lebten bis die Sowjets 1940 die Stadt einnahmen, Juden und andere nach Sibirien verschleppten. Dann besetzten die Nazideutschen das „Klein Wien“, errichteten 1941 ein Ghetto und deportierten Juden nach Transnistrien. Ich sitze mit meiner Freundin Hedy im Kaffeehaus in der Herrengasse und plaudere. Sie erzählt Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend, Mythen umranken die Geschichten, sie erzählt von den armen Juden und den reichen, erzählt über die Lyriker, erzählt wie sie und ihr Mann Paul Celan bei sich aufgenommen haben, als er 1944 aus dem Arbeitslager zurückkam in seine Geburtsstadt Czernowitz. Sein Vater starb im Arbeitslager an Typhus, die Mutter wurde erschossen.

Hermannstadt/Sibiu. Foto: Wollmann-Fiedler
Von meinem Czernowitztraum wache ich auf und gehe zurück in den Kammermusiksaal der Philharmonie im herbstlichen Berlin. Götz Teutsch, der Initiator des Philharmonischen Salons erzählt uns seine Geschichte über die Literatur und die dazu ausgewählte Musik und erzählt von seiner Freundschaft mit Edi Weissmann, dem geborenen Czernowitzer, der ihm beim Aussuchen der Literarischen Texte geholfen hat. Diese Texte liest Udo Samel, wie schon erwähnt. Er liest von Nora Gray, der Dichterin und Malerin „ Czernowitz ist überall“ aus dem Jahr 2004. 1929 wurde Nora Gray, in Wien geboren und starb dort 2011. Die „Hebräische Melodie“ für Violine und Klavier von Joseph Achron wurde hinreißend gespielt, und Udo Samel setzt seine Lesung mit Ausschnitten aus dem Reisebuch „Aus Halb-Asien“ mit der Geschichte „Von Wien nach Czernowitz“ von Karl Emil Franzos, fort. Karl Emil Franzos wurde 1848 in einem kleinen galizischen Dorf geboren, besuchte die Schule in Czernowitz und kam über Umwege nach Berlin, wo er 1904 starb und auch beerdigt wurde. Alan Berns Musikstück für Akkordeon kommt dazu, und Joseph Joachims Hebräische Melodie. Auch Georg Drozdowski schrieb über seine Heimatstadt Cernowitz, „ Die Stadt am Pruth“, wo er 1899 zur Welt kam. In Österreich lebte er weit später, in Klagenfurt am Wörthersee starb er 1987.
Rose Ausländer, geborene Scherzer, die wohl bekannteste Schriftstellerin aus Czernowitz wurde dort 1901 geboren, nach Lebensodysseen entschied sie sich 1965 für Düsseldorf und starb dort 1988. Paul Celan lernte sie in Czernowitz kennen. Karol Mikulis‘ Klaviermusik und Sergej Prokofjews „Ouvertüre über jüdische Themen“ umgarnen die Lyrik von Rose Ausländer „Czernowitz vor dem Zweiten Weltkrieg“ und die „Geschichte in der Nußschale“.
In Wischnitz, westlich von Czernowitz wurde 1912 Joseph Burg geboren und 2009 auf dem inzwischen sehr berühmten Jüdischen Friedhof in Czernowitz begraben. Auch in seiner jiddischen Muttersprache schrieb er und Udo Samel liest Burgs „Mein Debüt“ mit dem grausamen Ende. Alan Bern und Noah Bendix-Balgley spielen Berns Stück für“ Violine und Klavier“. Traurigkeit bringt Max Bruchs Jüdisches Gebet in den Kammermusiksaal. Dmitri Schostakowitschs Klaviertrio vermittelt Trauer und Klage.
Nach Czernowitz, in die Stadt seiner Geburt, kehrt Paul Celan 1944 aus dem Arbeitslager zurück. Über Bukarest und Wien, kommt er in Paris an, wo er 1970 sein Leben beendet. 1920 wurde er geboren. Paul Celans „Fuge“ von 1944/45, beendet das Leben der Juden in Czernowitz, erzählt von dem unendlichen Leid, das sie ertragen mussten. Mythen und Klänge aus einer fernen Welt, einem fernen Land, einer untergegangenen Kultur stimmen tief traurig.
Von Christel Wollmann-Fiedler
Frau Wollmann-Fiedler ist Fotografin, Autorin und Journalistin, sie lebt und arbeitet in Berlin.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende, oder werden Sie Mitglied der Israel-Nachrichten.
Durch einen technischen Fehler, ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet!
Leserkommentare geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Wie in einer Demokratie ueblich achten wir die Freiheit der Rede behalten uns aber vor, Kommentare nicht, gekuerzt oder in Auszuegen zu veroeffentlichen. Anonyme Zuschriften werden nicht beruecksichtigt.