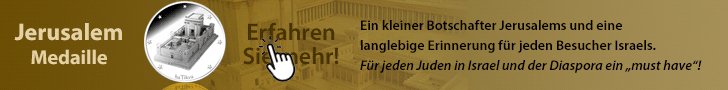
Von Oberleutnant zur See Grosser und Leutnant zur See Schmoeckel, Drontheim, im April 1940
Das Oberkommando der Wehrmacht gab diesen „Tatsachenbericht“ im Kriegsjahr 1940 bekannt.
„Morgen 09.00 Uhr seeklar“ stand eines Tages auf einer schwarzen Tafel am Fallreep unseres Schiffes. Endlich der erlösende Befehl, auf den die ganze Besatzung seit langem mit Spannung wartete. Überall wusste man, dass irgendetwas in der Luft lag, aber keiner konnte sich auch nur ein annäherndes Bild verschaffen, was das sein konnte. Strahlender Sonnenschein lag am nächsten Morgen über unserem Schiff, aber keine Anzeichen eines unmittelbaren Inseegehens waren festzustellen. Stattdessen: Alle Mann achteraus zur Ansprache des Kommandanten. Wir alle sind überrascht und enttäuscht, scheinbar ist es wieder nichts mit der ersehnten Unternehmung gegen England.
Voller Erwartung stehen wir achtern auf der Schanze vor unserem Kommandanten und hören begeistert von unserer neuen Aufgabe; dennoch hatte der Kommandant sehr ernst gesprochen, und wir wussten, daß ihre Lösung schwer werden würde. Sofort nach dem Wegtreten begannen die Vorbereitungen. Sämtliche Wohnräume der Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften im Batteriedeck wurden geräumt und für Kameraden von der Armee hergerichtet. Kurz nach Vollendung dieser Vorbereitungen trafen dann auch drei lange Eisenbahnzüge ein und hielten vor dem Schiff, voll beladen mit Soldaten, Maschinengewehren, Flammenwerfern, Pioniergerät, Munition und Proviant.
Unmöglich schien es, das alles an Bord unterzubringen; denn auf einem modernen Kriegsschiff ist der Raum ohnehin schon äußerst knapp. Aber das gute Zusammenarbeiten der Schiffsführung und den Offizieren des Heeres, das kameradschaftliche Entgegenkommen zwischen Seeleuten und Gebirgsjägern und die allgemeine Begeisterung, ein ganz großes, kriegsentscheidendes Unternehmen durchzuführen, wirkten Wunder. Kurz vor Dunkelheit waren sämtliche Waggons leer, alles war an Bord, und Kriegsmarine und Heer saßen zufrieden und fröhlich beim gemeinsamen, wohlverdienten Abendessen. Zwei Stunden später waren die Leinen los, der Kriegsmarsch nach Norden begann.
Am nächsten Morgen wurde man geweckt durch das schwere Stampfen und Schlingern des Schiffes. Es mußte schwere See draußen sein; denn wenn so ein dickes Schiff wie das unsere so tobt, musste schon was los sein, und wirklich: Windstärke 7 – 8, schwere See und schlechte Sicht. Der Wettergott schien es gut mit uns zu meinen, denn wir entzogen uns dadurch der englischen See- und Luftaufklärung. Mit Höchstfahrt kämpften die einzelnen Einheiten gegen die Schwere See; bis hoch über die Brücke zischten die Brecher, die ganze Back war unter Wasser und nicht zu betreten. Zunächst ging unser Vormarsch planmäßig weiter, ohne auf irgendeinen Feind zu stoßen.
Aber nicht lange dauerte es, da kam auch schon der vorausgeahnte Angriff. Schrill und unbarmherzig reißt uns, die wir auf Kriegs-Freiwache sind, die Alarmglocke aus dem Schlaf. Da geht es auch schon los: Schwere, dumpfe Erschütterungen scheinen den riesigen Schiffskörper regelrechte Sprünge zur Seite ausführen zu lassen; das können nur schwere Bomben sein, die auf der Wasseroberfläche detonieren. Sechs oder sieben Stück zählen wir, aber keinen Treffer. Bald danach hüllt uns die schützende Dunkelheit wieder ein und entzieht uns weiterer Feindberührung. So gern wir uns auch endlich einmal mit dem Engländer herumgeschlagen hätten, mußten wir dennoch nach Möglichkeit ihm ausweichen, denn unsere Aufgabe war, unsere kostbare Menschen- und Materialladung sicher und unversehrt nach Drontheim zu bringen, und die Durchführung dieser Aufgabe durfte nach Möglichkeit nicht durch das Risiko eines Gefechtes gefährdet werden.
Ganz sollte uns das allerdings nicht gelingen. Nachdem eine ganze Nacht und ein halber Tag Höchstfahrt uns hoch in das Nordmeer hatten vordringen lassen und wir unserem Ziele schon ganz nahe waren, kam plötzlich ein Funkspruch eines unserer Begleit-Zerstörer: „Bin im Gefecht mit englischem Zerstörer.“ Bald darauf ein zweiter von der Führung, der uns den Befehl gab, unseren Zerstörer zu entlasten und selbst den Gegner anzugreifen. Mit Hartruder scherten wir aus der Formation und nahmen Kurs auf den Feind. Nach wenigen Minuten erwischten wir ihn. „Klar Schiff zum Gefecht“, kreischt die Alarmanlage, alles auf Gefechtsstation. Wir sitzen tief untern unter Panzerdeck auf unserer Gefechtsstation und können, wie gestern den Bombenangriff, auch heute den Verlauf des Gefechtes nur akustisch wahrnehmen durch das Dröhnen der Aufschläge und das Donnern der eigenen Salven.
Aber die Meldungen im Gefechtsfernsprecher geben auch uns hier unten ein genaues Bild des Kampfes. Als der Engländer unser dickes Schiff plötzlich sieht, glaubt er zunächst, es mit einem eigenen Kreuzer zu tun zu haben, aber welch furchtbares Erwachen, als unsere ersten Brocken zu ihm herüberlangen. Jetzt beginnt ein wahrer Hexentanz für ihn. Salve auf Salve unserer schweren Artillerie läßt jedes Mal unser Schiff leicht erbeben, dazwischen das helle Aufbellen der leichten Geschütze. Wir schießen wieder einmal aus sämtlichen Knopflöchern, wie wir es nennen. Dazwischen immer die kurzen, knappen Meldungen der Gefechtsbeobachter: „Volltreffer in die Brücke des Gegners“, „schwere Detonation im Achterschiff“, „Gegner zeigt starke Schlagseite“, „schweres Schwarzqualmen verdeckt das Ziel“.
Plötzlich fällt bei uns im Raum alles durcheinander, ein ganz hartes Drehen legt das Schiff stark auf die Seite, wir sehen uns ernst an, aber da kommt auch schon die Meldung von oben: „Haben mehrere Torpedolaufbahnen ausmanövriert.“ Scheint ein zäher Bursche zu sein, dieser Tommy, wenn er jetzt noch versucht, Torpedos zu schießen. Langsam geht es mit ihm zu Ende. Er liegt völlig auf der Seite, seine Waffen sind ausgefallen, er ist wehrlos. Unsere Artillerie schweigt. Einige Minuten später noch ein kurzer Luftblubber auf dem Wasser, und die Engländer sind um einen Zerstörer ärmer. 40 Überlebende nehmen wir bei schwerstem Seegang und mitten in feindlichen Gewässern, gestoppt liegend, an Bord. Ein Funkspruch: „Habe Fühlungshalter versenkt“, beendet das Drama eines englischen Zerstörers.
Ein glücklicher Tag war das für uns, aber das Schlimmste stand noch vor uns: Der Einbruch in den Drrontheimfjord und die Landung unserer Truppen. Wir wissen, daß die Einfahrt nur einige hundert Meter breit ist und daß sie durch Batterien schwersten Kalibers geschützt ist. Aber wir müssen durch, und allen klingen noch die ruhigen Worte des Kommandanten in den Ohren: „Und wenn die Norweger doch schießen, dann werden wir uns in einen schreckenverbreitenden, feuerspeienden Vulkan verwandeln und das niederkämpfen, was uns hindert.“ Der denkwürdige 9. April beginnt. als wir kurz vor den Batterien im Drontheimfjord standen, sammelten wir uns erst mir unseren Zerstörern, die in Kiellinie sich hinter uns aufstellten.
Auf Winnetous Pfaden schlichen wir uns so geräuschlos wie möglich heran, abgeblendet, in stockfinsterer, kohlrabenschwarzer Nacht, bis wir ganz dicht heran waren. Dann gab es nur eins: Äußerste Kraft voraus und durch! Ein Bewachungsdampfer entdeckt uns plötzlich in seinem Scheinwerferkegel. Er morst uns an: „Name des Schiffes?“ Wir geben nach kurzer Pause einen langen „Senf“ rüber. Dabei werden einige Fehler eingestreut; dann fangen wir wieder von vorne an. Wir wollen Zeit gewinnen, die kritischen 20 Minuten haben begonnen. Schießen sie, schießen sie nicht? Alles fiebert vor Erregung. Es ist der spannendste Augenblick meines Lebens. Der Norweger hat nicht verstanden, wunderbar, er gibt uns herüber: „Bitte wiederholen!“
Als dies geschehen ist, haben wir die schlimmste Ecke schon überwunden. Da blitzen auch an Land Scheinwerferkegel auf. Jedem Scheinwerfer, der uns anleuchtet, wird entgegengeleuchtet, damit er wirkungslos wird. Schon haben wir die Hälfte der Strecke passiert. Immer noch fällt kein Schuß. Langsam fangen wir an aufzuatmen. Da blitzt drüben Mündungsfeuer auf, jämmerlich bellen ihre Geschütze nach uns. Aber nach zwei Salven unserer schweren Artillerie sind wir aus dem Bestreichungswinkel der Batterien heraus. Wir sind durch, wir haben es geschafft. Dicht hinter den Batterien stoppen einige unserer Zerstörer und werfen ihre eingeschifften Heeressoldaten an Land, die die Batterien sofort besetzen sollen, damit keiner von den Engländern, die aller Voraussicht nach gleich hinter uns kommen werden, mehr durch kann.
Wir setzen unseren Weg fort. Es bleibt nur wenig Zeit, bis wir Drontheim erreichen werden. Diese Zeit wird kräftig ausgenutzt zum Klarmachen: Aussetzen unserer Truppen. Fallreeps werden angebracht, die Beiboote klargemacht zum Aussetzen, Proviant, Munition und Gepäck für unsere feldgrauen Kameraden an Deck gemannt. In dieser Zeit sind wir auch schon dort. Der Ort liegt friedlich vor uns. Keine Menschenseele ist zu sehen. Es war ja auch noch ganz früh am Morgen. Kaum ist der Anker gefallen, da sind unsere Boote auch schon ausgesetzt. Nun kommen die Truppen dran. Die sind froh, endlich das Schiff verlassen zu können. Die Schaukelei ist ihnen doch gelegentlich unangenehm gewesen, besonders unheimlich war ihnen aber die Ballerei gestern, als wir den englischen Zerstörer versenkten, und heute früh. Ehe es sich die Norweger versehen, sind so viele Truppen an Land, daß nichts mehr passieren kann. Alle wichtigen Punkte sind besetzt.
Und diesen absoluten Schwachsinn hat die deutsche Bevölkerung mit Begeisterung aufgenommen, und was noch viel schlimmer war, für bare Münze genommen.
Von Rolf von Ameln
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende, oder werden Sie Mitglied der Israel-Nachrichten.
Durch einen technischen Fehler, ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet!
Leserkommentare geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Wie in einer Demokratie ueblich achten wir die Freiheit der Rede behalten uns aber vor, Kommentare nicht, gekuerzt oder in Auszuegen zu veroeffentlichen. Anonyme Zuschriften werden nicht beruecksichtigt.