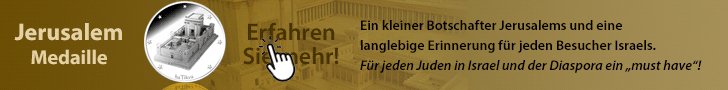
Die Brücke „Aristide Briand“, durch tausend Bajonette nach Vichy
Wie perfide die deutsche Propagandamschinererie von Goebbels das Volk zur Begeisterung für den Westfeldzug mobil machte, soll an diesem Originalbericht „Von einem, der dabei war“, wiedergegeben werden.
Ich sehe auf die Uhr und entziffere mühsam: 1:45 Uhr. Die milde Nacht des südfranzösischen Sommers liegt über dem Land. Es ist eine wunderbare, gleißende Sternennacht. Und doch ist es ungemütlich. Denn wir haben die Feindberührung verloren. Wir hocken müde auf unseren Raupenfahrzeugen, und nur an eines hätten wir denken mögen: Schlafen, schlafen, schlafen. In einem Dorf, Bessey hieß es, mussten wir gewaltsam eine Tankanlage aufbrechen. Der Brennstoff war uns ausgegangen. Aber wo ist bloß der Feind? Weiter…weiter, die Landstraße flussaufwärts. Akazien waren der Landstraße angesäumt. Noch nie hatte diese Landschaft einen deutschen Soldaten gesehen. Aber wo mochte bloß der Franzmann stecken? Ich sehe wieder auf die Uhr: 4:35 Uhr. Wir schreiben heute den 19. Juni 1940. Da stehen schon ein paar Kradschützen neben uns, auch zwei Pak-Geschütze, ferner ein Häuflein Infanterie. Durch den hohen Weizen prescht ein Wagen heran. Ein Offizier steht aufrecht darin, ein Oberstleutnant. Er verlangt unseren Zugführer, den Leutnant. Sagt: „Sie haben den Auftrag, mir ihrem Zug und einem Halbzug Schützen meines Regiments in raschem Stoßtrupp die Brücke in Vichy sofort zu besetzen, die Sprengung zu verhüten und Widerstand, der zu erwarten ist, zu brechen.“ Unser Zugführer wiederholt den Befehl. Ein Blick auf die Karte und einen auf den nahen Kilometerstein: „Vychi 42 Kilometer.“ Dort ist der Halbzug Schützen mit 2 Maschinengewehren. „Aufsitzen, Anwerfen!“ Ich muss schnell zählen: 16 Infanteristen auf ihren Kübelwagen und unser Zug leichte Flak, drei Geschütze mit 22 Mann. Wir durchfahren Dörfer; St. Gerand le Puy, Magnet, Cusset heißen sie. Kein feindlicher Schuss will uns aufhalten.
Aber Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge! Eine Armee des Elends, der Not, der Verzweiflung. Weiter, weiter! Die Fahrzeuge klettern einen Berg hoch. Da fällt der Blick ins Tal: Das ist Vychi. Das ist der Weltbadeort, der uns bisher tausendmal auf den Etiketten der Mineralwasserflaschen begegnet war. Dort also ist unser Ziel. Hinter den ziegelroten Dächern schimmert der Fluss, milchig und weiß. Durchs Glas erkennen wir auch die Brücke. Zwei Soldaten erheben sich aus einem Getreidefeld, Poilus, mit erhobenen Händen; am Rand der Straße sitzen noch zwei, ergeben sich… Unsere Fahrzeuge rasen weiter, eilen den Berg hinunter. In einem Park stehen auf ihren steinernen Postamenten pralle, rundliche Putten, mit allegorischem Weinlaub umwunden. Ein Poilu steht dabei, barhäuptig, den Stahlhelm einem dieser rundlichen, steinernen Wesen auf den Kopf gestülpt, das Gewehr angelegt daneben. Er wird nicht mehr schießen, hebt die Hände. Unsere Fahrzeuge verlangsamen das Tempo. Merkwürdig, wirklich merkwürdig. Kein Widerstand, kein Schuss, nichts. „Vorsicht, Herrschaften!“, ruft uns der Leutnant zu. Das kennen wir ja. Sie lassen immer alles dicht rankommen. Wir haben die ersten Häuser Vychis erreicht. Ungezählte Flüchtlinge, die uns anstieren. Was wird jetzt geschehen? Da ist auch schon die Khakifarbe des Poilus. Runter von unseren Fahrzeugen. 45 Mann und 3 Offiziere lassen sich entwaffnen. Es ist die Nachhut der französischen Truppen. Sie ist überrascht. Wir kommen zu plötzlich. Die Gewehre auf einen Haufen, Benzin drüber und ein Streichholz dran. So lässt sich ihre Armee entwaffnen, die stolze, große, gewaltige und ruhmreiche Armee Frankreichs!
„Aufgesessen!“ Weiter… Die Fahrzeuge rasen durch die Straßen, ein ungeheures Getöse verursachend. Vielleicht sind es Panzer, mögen sie denken. Wir haben den Stahlhelm ganz fest gebunden, den Gewehrschaft ganz fest in den Fäusten. Es ist ziemlich dicke Luft, wir können es fast körperlich fühlen. Mit seine ganzen Unerschrockenheit und Verwegenheit rast unser Leutnant auf dem ersten Geschütz vornweg. Wir fahren wie durch einen Hexenkessel. Tausende, Zehntausende Zivilisten stehen auf den Bürgersteigen, zittern, viele flüchten in die Hausflure. Und es wimmelt von bewaffneten französischen Soldaten. Bringt denn niemand von ihnen sein Gewehr in Anschlag? Sie sind ratlos, kopflos, überrumpelt. Wir rasen durch das pompöse Kurviertel. Ein Kurviertel, wie sie gemalt in teuren Prospekten stehen. Alles sieht nach vielem Geld aus. Man spürt es förmlich: Hier ist das gleißende Frankreich, das Eldorado für den Müßiggang der Geldbarone; Luxus und Komfort an allen Enden, unter jeder Arkade, in jedem Pavillon und um jede Fontäne. Aber nun promenieren und flanieren sie nicht mehr über die Beete mit den Rhododendren, den Feuerbüschen und den Gladiolen flüchten die Poilus, werfen die Gewehre in einen Tümpel, in dem vielleicht Goldfische schwimmen, reißen ihr Koppelzeug herunter. Nur fort damit. Sie rennen, rennen, irgendwohin. Fort aus dem Gesichtskreis der Deutschen. Ich muss daran denken: Wir sind doch nur 38 Mann! 38 deutsche Soldaten! Wo ist ein einziger beherzter französischer Offizier, der uns Einhalt bietet? Zahllose französische Offiziere verschwinden bei unserem Nahen in den Hausfluren. 30.000 Einwohner soll die Stadt zählen, 300.000 Flüchtlinge sind in ihr untergebracht, Tausende bewaffnete Franzosen! Rauf auf die Brücke!
Die Brücke ist heil, Gott sei Dank! Aber da sind Barrikaden an der jenseitigen Brückenauffahrt. Fünf Lastwagen hat man quer über die Brücke gestellt, mit Sand beladen, mit schweren Holzplanken verbunden. Drohend und unheimlich sieht es aus. Noch immer ist kein Schuss gefallen. Wird sie gleich in die Luft fliegen, unsere Brücke? Wir rattern hinüber, und wir denken noch, das scheint gut zu gehen. Da knallt es. – Sofort empfängt uns heftiges Maschinengewehr- und Gewehrfeuer. Die Schutzscheibe eines unserer Fahrzeuge klirrt und splittert. Aber da brüllt unser Leutnant: „Feuer frei!“ Und dann feuern wir unseren Feuersegen hinüber. Sehr sicher bestreichen wir mit unseren braven Kanonen die Ufer, die beiden Maschinengewehre unserer Infanteristen tacken hinüber, Karabinerschüsse gehen wohlgezielt in die Parks. Drüben beginnen sie zu flüchten. Zahllose feindliche Soldaten nehmen die Beine unter die Arme. Nur fort aus dem Feuerbereich der Deutschen. Die Brücke geht noch immer nicht in die Luft. Wir übersteigen die Barrikade; die dahinter standen, die Poilus, die uns mit ihrem Feuer bedachten, sind in die Parks geflüchtet. Achtzig Mann geben sich gefangen. Sie sind schnell entwaffnet. Unterdessen wird die Brücke untersucht. Wir finden keine Sprengkörper, keine Zündschnur. Wir kamen zu überraschend. In zwei Tagen, so sagt ein gefangener Offizier aus, hätten sie mit unserem Erscheinen gerechnet. Zum Sprengen haben sie keine Zeit mehr gefunden.
Ein Artilleriegeschütz, mit Rohr gegen uns, wird noch in raschem Zugriff genommen, die Geschützbedienung zu Gefangenen gemacht. Dann gehen wir beiderseits der Brücke an den Auffahrten in Stellung, unser Geschütz mit sechs Mann auf der Stadtseite. Noch einmal werden die Parks durchkämmt. Überall, sobald wir sie anrufen, werfen die Poilus die Waffen fort, flüchten in die Stadt. Noch schnell in verwegener Fahrt mit einem Geschütz zum Postamt in die Stadt. Der Herr Postdirektor ist ein seriöser Herr, vom Scheitel bis zur Sohle Franzose. Wie eingeschüchterte Hühner sitzen die Telefonistinnen an ihren Strippen. „Selbstverständlich“, sagt der Herr Direktor mit wächsernem Gesicht zu unserem Leutnant, „selbstverständlich, wenn Sie es wünschen, wird der Telefon- und Telegraphenverkehr außer Betrieb gesetzt“. Wir wünschen es. Die Damen mit den kirschroten Lippen und ihren verwegenen roten Fingernägeln dürfen nach Hause gehen. Zwei Posten bleiben zurück. Dann halten wir fünf Stunden lang die Brücke, an deren Auffahrten „Le Pont Aristide Briand“ steht. Fünf Stunden lang müssen wir zu dritt, den Karabiner unterm Arm, mit Handgranaten bewaffnet, die Brückenauffahrt zur Stadt von Tausenden Menschen freihalten, die Straßen immer wieder säubern und alles auf die Bürgersteige zurückdrängen. Einen Elsässer haben wir als Dolmetscher auserkoren. Er übersetzt, was ich ihm sage: „Sagen Sie den Leuten, die Straßen müssten freibleiben, gleich kämen die deutschen Truppen durchmarschiert, Vichy sei völlig umstellt. Bitten Sie die Leute, sie möchten auf die Bürgersteige gehen. Legen Sie die Betonung aber auf das Wort =bitte=..! Wir Rheinländer seien zwar in der Besatzungszeit mit Kolbenstößen von den Straßen gejagt worden, aber wir Wilden, wir Barbaren, seien doch, wie sie sehen sollten, bessere Menschen“ Um 12:50 Uhr mittags kommt als erster unserer Division, im Wagen stehend, unserer Oberstleutnant, der uns in der Nacht den Befehl gegeben hatte, Vichy zu nehmen und die Brücke zu besetzen. Fünf Stunden haben wir ausgehalten. Er drückt unserem Leutnant sehr kräftig die Hand. Gleich dahinter kommt die Spitze der Division, eine Kompanie Infanterie.
„Wo wollt ihr noch hin?“, fragen wir die Kameraden. – „Wir leiden an Verfolgungswahn!“, sagt einer und grinst und lacht.
Wir haben das Lachen nicht verlernt!
Und der Propagandaapparat der Nazis arbeitete munter in diesem Stil weiter; – „Sieg Heil“ brüllten viele und haben diesen Schwachsinn für bare Münze genommen!
Von Rolf von Ameln
Redaktion Israel-Nachrichten.org
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende, oder werden Sie Mitglied der Israel-Nachrichten.
Durch einen technischen Fehler, ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet!
Leserkommentare geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Wie in einer Demokratie ueblich achten wir die Freiheit der Rede behalten uns aber vor, Kommentare nicht, gekuerzt oder in Auszuegen zu veroeffentlichen. Anonyme Zuschriften werden nicht beruecksichtigt.